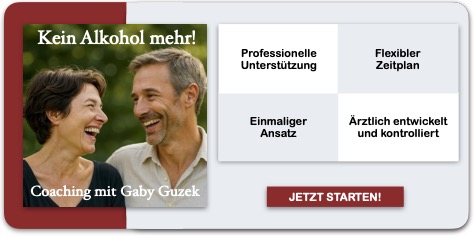Alkohol ist nach Gallensteinen die wichtigste Ursache einer Pankreatitis. Frühe Zeichen sind unspezifische Oberbauchbeschwerden nach dem Essen; ohne Abstinenz drohen chronische Schäden mit Verdauungsstörungen und Diabetes Typ 3c.
Von Dr. med. Bernd Guzek
Was ist die Bauchspeicheldrüse?
Die Bauchspeicheldrüse ist eines der geduldigsten Organe, das wir haben. Sie fällt meist erst auf, wenn es fast zu spät ist. Wenn sie sich schmerzhaft entzündet, ist sehr oft der Alkohol schuld.
Der medizinische Name ist Pankreas – es liegt quer im Oberbauch, direkt hinter dem Magen. Die Bauchspeicheldrüse ist ein unscheinbares, aber lebenswichtiges Organ mit zwei zentralen Aufgaben: Sie produziert Verdauungsenzyme, die Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate im Dünndarm aufspalten. Und sie steuert den Blutzucker, indem sie Hormone wie Insulin und Glukagon ausschüttet. Gerät dieses Organ aus dem Gleichgewicht, geraten sowohl Verdauung als auch Stoffwechsel massiv durcheinander.
Ärzte unterscheiden zwischen akuter und chronischer Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Hauptursachen der akuten Pankreatitis sind Gallensteine und Alkohol. Alkohol ist hier in etwa 25–35 % der Fälle der Auslöser. Bei der chronischen Pankreatitis liegt Alkohol dann aber als Ursache ungeschlagen vorn: In Europa ist er für etwa 60–80 % aller chronischen Entzündungen verantwortlich.
Alkohol zerstört die Bauchspeicheldrüse
Das Risiko für die Bauchspeicheldrüse steigt ab etwa 80–150 g reinem Alkohol pro Tag, wenn dieser Konsum über viele Jahre hinweg erfolgt. Gemeint sind damit meist zehn Jahre oder mehr regelmäßigen, übermäßigen Trinkens. Nicht jeder Alkoholiker entwickelt eine Pankreatitis, aber wer zusätzlich raucht oder eine genetische Veranlagung mitbringt, hat ein noch höheres Risiko.
- 80 g Alkohol entsprechen etwa 2 Litern Bier oder 0,8 Litern Wein.
- 150 g Alkohol sind rund 1,5 Litern Wein oder 0,4 Litern Schnaps (40 %).
Hinweis: Angaben beziehen sich auf reinen Alkohol (Ethanol).
Frühe Symptome
Die alkoholbedingte Pankreatitis kündigt sich oft schleichend an. Nach fettreichen Mahlzeiten bemerkt der Betroffene unspezifische Oberbauchschmerzen. Dazu kommen Blähungen, Völlegefühl und gelegentliche Durchfälle mit fettigem Stuhl.
Diese frühen Zeichen werden häufig fehlinterpretiert – und die Haxe dann noch mit ein oder zwei Klaren runtergespült, weil man damit angeblich die Fettverdauung „ankurbelt“. Viele halten das zunächst für harmlose „Magenprobleme“ oder eine Unverträglichkeit. In Wahrheit signalisiert der Körper hier bereits, dass die Bauchspeicheldrüse unter erheblichem Stress steht.
Spätere Symptome
Wird unverdrossen weiter gezecht, verschärfen sich die Beschwerden. Die nächste Stufe sind heftige, gürtelförmige Schmerzen im Oberbauch, die bis in den Rücken ausstrahlen. Hinzu kommen Übelkeit, Erbrechen und Fieber bei akuten Schüben. Bei der chronischen Entzündung treten schwerwiegende Verdauungsprobleme auf: Fettstühle, Gewichtsverlust und Mangelzustände.
Besonders gravierend: der Diabetes mellitus Typ 3c. Er entsteht, wenn die insulinproduzierenden Zellen im Pankreas durch die chronische Entzündung zerstört werden. Anders als beim Typ-2-Diabetes liegt hier kein Problem der Insulinempfindlichkeit vor, sondern ein echter Insulinmangel – in der Regel mit Insulinpflicht für den Rest des Lebens. Neben dem Insulinmangel fehlt oft auch Glukagon. Hypoglykämien können deshalb schwerer einschätzbar sein
| Stadium | Typische Symptome |
|---|---|
| Frühe Phase | Oberbauchschmerzen, Völlegefühl, Blähungen, gelegentliche Fettstühle |
| Später / akut | Heftige Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Fieber |
| Chronisch | Dauerhafte Verdauungsprobleme, Fettstühle, Gewichtsverlust, Diabetes Typ 3c |
Behandlung
Merksatz: Entweder verzichtest du auf Alkohol, oder auf deine Bauchspeicheldrüse. Sachlicher ausgedrückt: Die wichtigste und unverzichtbare Maßnahme ist absolute Alkoholabstinenz. Hört man nicht komplett und konsequent auf zu trinken, bleibt jede Therapie wirkungslos. Grundsätzlich und immer.
So läuft die Behandlung ab
- Ambulante Phase: Gründliche Diagnostik (Blutwerte, Ultraschall, ggf. CT/MRT) und sofortiger Alkoholverzicht. Schmerztherapie, diätetische Maßnahmen und erste Enzympräparate können die Verdauung stabilisieren.
- Akute Pankreatitis (Klinik): Intensive Überwachung, i. v. Flüssigkeit, starke Schmerzmittel, Nahrungskarenz oder Sondenernährung; bei Komplikationen Antibiotika oder endoskopische Eingriffe (z. B. Entfernung von Pankreasgangsteinen).
- Chronische Pankreatitis: Dauerhafte Enzymsubstitution (Pankreatin), konsequente Schmerztherapie, Blutzuckerkontrollen und meist Insulin bei Typ 3c. Bei Gangverengungen/Abszessen können endoskopische oder operative Maßnahmen erforderlich sein.
Nahrungsergänzungsmittel
Vitamin- und Mineralstoffpräparate können die Pankreatitis nicht bessern, zur alleinigen Behandlung sind sie ungeeignet. Klartext: Vitamine schlucken und weiter saufen macht den Rausch nur teurer. Der Bauchspeicheldrüse hilft das nicht im Mindesten. Abstinenz ist unverhandelbar.
Sie können jedoch Defizite ausgleichen, die durch die gestörte Verdauung entstehen – teils schon in der Klinik über Infusionen, später oral.
- fettlösliche Vitamine (A, D,
- E, K)
- Vitamin B12
- Mineralstoffe: Magnesium, Zink, Selen
- Omega-3-Fettsäuren (entzündungsmodulierend, falls verträglich)
Die Auswahl erfolgt ärztlich kontrolliert und individuell, sie kann auch ambulant sinnvoll sein.
Gefahr von Dauerschäden
Jede akute Pankreatitis kann lebensgefährlich verlaufen. Bei wiederholten Schüben entwickelt sich fast zwangsläufig ein chronischer Dauerschaden: Die Bauchspeicheldrüse vernarbt, die Enzymproduktion versiegt und der Blutzucker entgleist.
| Dauerschaden | Folgen |
|---|---|
| Fibrose | Unumkehrbarer Verlust von Pankreasgewebe |
| Exokrine Insuffizienz | Verdauungsprobleme, Fettstühle, Mangelzustände |
| Endokrine Insuffizienz | Diabetes mellitus Typ 3c, Insulinpflicht |
| Karzinomrisiko | Deutlich erhöhtes Risiko für Pankreaskrebs |
| Schmerzsyndrom | Chronische, schwer therapierbare Oberbauchschmerzen |
Fazit
Alkohol ist der entscheidende Risikofaktor für die Pankreatitis. Sie beginnt oft unauffällig, endet aber nicht selten mit schweren Dauerschäden. Nur absolute Abstinenz und konsequente medizinische Betreuung können das Fortschreiten aufhalten.
FAQ
Ab wie viel Alkohol entsteht eine Pankreatitis?
Das Risiko steigt ab etwa 80–150 g reinem Alkohol täglich, über viele Jahre hinweg.
Das entspricht ca. 2 Litern Bier oder 0,8 Litern Wein (80 g) bzw. 1,5 Litern Wein oder 0,4 Litern Schnaps (150 g).
Nein. Aber Alkohol ist die Hauptursache: rund 30 % der akuten und 70 % der chronischen Pankreatitiden gehen auf Alkohol zurück.Bekommt jeder Alkoholiker eine Pankreatitis?
Rauchen und genetische Faktoren erhöhen das Risiko zusätzlich.
Unklare Oberbauchschmerzen, Völlegefühl und Blähungen nach dem Essen, dazu gelegentliche Fettstühle.Welche ersten Symptome sollte ich ernst nehmen?
Diese „kleinen“ Beschwerden sind oft ein Frühwarnsignal.
Es kommt zu heftigen, gürtelförmigen Bauchschmerzen, oft mit Übelkeit, Erbrechen und Fieber.Was passiert bei einer akuten Pankreatitis?
Das ist ein Notfall, Betroffene müssen in die Klinik.
Nach einer akuten Pankreatitis ist Erholung möglich, wenn die Ursache beseitigt wird.Kann sich die Bauchspeicheldrüse wieder erholen?
Bei der chronischen Form ist die Zerstörung des Gewebes unumkehrbar.
Nein. Nahrungsergänzung kann Mangelzustände ausgleichen, ersetzt aber niemals Abstinenz.Hilft es, wenn ich weiter trinke, aber Vitamine nehme?
Wer weiter trinkt, zerstört das Organ – auch mit Vitaminen im Blut.
Ein Diabetes, der entsteht, wenn die insulinproduzierenden Zellen durch die Pankreatitis zerstört werden.Was ist Diabetes Typ 3c?
Er unterscheidet sich vom Typ 2 Diabetes: Betroffene haben einen echten Insulinmangel und sind meist insulinpflichtig.
Aktuelle Beiträge in unserem Blog
- Video-Blog: Dry January– mehr Veränderung, als viele erwarten
- Holiday-Heart-Syndrom: Wenn Alkohol Deinen Herzschlag zur Rave-Party macht
- Wie Alkohol den Blutdruck dauerhaft in die Höhe treibt
- Weihnachten ohne Alkohol ist machbar!
- Warum Ex-Trinker oft müde, nervös und gereizt bleiben – die unterschätzte Rolle von Vitaminmangel
- Rückfall – „alles verloren“ oder „macht nichts“?
- Wie Alkohol das wichtigste Vitamin für Dein Gehirn systematisch zerstört
- Nüchtern über den Weihnachtsmarkt – geht das überhaupt?
- Bin ich schon Alkoholiker?
- Träumen vom Alkohol – Rückfallgefahr oder gutes Zeichen?

Dr. med. Bernd Guzek
Arzt, Autor, Angehöriger & Mitbegründer von Alkohol adé
Beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den biochemischen Grundlagen von Sucht und Hirnstoffwechselstörungen sowie deren Beeinflussung durch Nährstoffe.