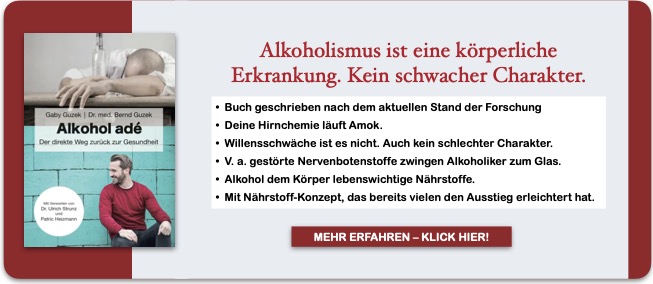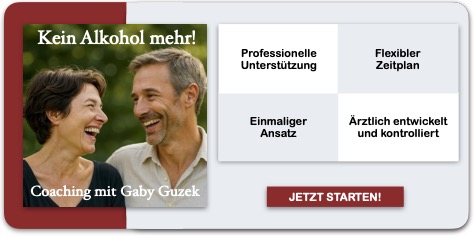Vitamin D gilt als Sonnenvitamin – wichtig für Knochen, Muskeln und Abwehr. Doch neuere Forschung deutet darauf hin, dass es auch das Belohnungssystem im Gehirn beeinflusst. Ein Mangel könnte das Risiko für Abhängigkeit erhöhen – und eine Ergänzung helfen, Stabilität zurückzugewinnen.
Von Dr. med. Bernd Guzek
Zunehmend Hinweise auf die Rolle des Vitamin D-Mangels bei Suchtentstehung
Wer an Vitamin D denkt, hat meist Knochen, Muskeln und Immunsystem im Kopf – nicht aber Alkohol oder Drogen. Doch genau hier könnte das Sonnenvitamin eine bislang unterschätzte Rolle spielen. Mehrere neue Studien weisen darauf hin, dass ein Mangel an Vitamin D das Belohnungssystem des Gehirns empfindlicher für Suchtreize macht.
Forscher sprechen sogar von einem möglichen „Schlüsselvitamin gegen Abhängigkeit“. Auch wenn die spannende Hypothese noch nicht endgültig bewiesen ist, wächst die Datenlage – außerdem ist es leicht, für einen ausgeglichenen Vitamin D-Spiegel zu sorgen.
Vitamin D – mehr als nur Sonnenvitamin
Vitamin D wird im Körper durch Sonneneinstrahlung gebildet – genauer gesagt durch UV-B-Licht, das die Haut anregt, aus Cholesterin-Vorstufen das Hormon Cholecalciferol (Vitamin D₃) zu bilden. In der Leber und den Nieren wird daraus die aktive Form Calcitriol, die im Körper wie ein Signalstoff wirkt.
Lange galt Vitamin D als reines Knochen-Vitamin. Inzwischen weiß man, dass es in über 2.000 Genen mitwirkt und in nahezu jeder Körperzelle eigene Rezeptoren (VDR) vorhanden sind – auch im Gehirn, in den Muskeln, in der Bauchspeicheldrüse und im Immunsystem. Es steuert Entzündungsprozesse, Zellschutz, Hormonbildung und die Ausschüttung von Botenstoffen im Nervensystem.
Im Gehirn unterstützt Vitamin D die Produktion von Dopamin, Noradrenalin und Serotonin – also genau jener Stoffe, die Antrieb, Stimmung und Belohnung regulieren. Dadurch wirkt es nicht stimulierend im engeren Sinn, sondern stabilisierend: Es dämpft übermäßige Erregung und stärkt gleichzeitig die Regenerationsfähigkeit der Nervenzellen.
Ein ausgeglichener Vitamin-D-Spiegel hilft dem Körper also, Stress- und Reizverarbeitung im Gleichgewicht zu halten. Das erklärt, warum Mangelzustände häufig mit Antriebslosigkeit, Reizbarkeit oder depressiven Verstimmungen einhergehen – und warum gerade Menschen mit Suchterkrankungen, deren Belohnungssystem ohnehin überfordert ist, besonders empfindlich auf niedrige Werte reagieren.
Was macht Vitamin D in unserem Gehirn?
Vitamin D wirkt nicht nur auf Knochen und Muskeln, sondern auch direkt auf das Gehirn. Es reguliert Botenstoffe, die Motivation, Stimmung und Suchtdruck beeinflussen. Forscher vermuten, dass Vitamin D nicht nur Knochen und Immunsystem beeinflusst, sondern direkt in die Steuerzentrale des Belohnungssystems eingreift. Gemeint sind Hirnregionen wie das ventrale Tegmentum, der Nucleus accumbens und der präfrontale Cortex. Dort arbeiten Nervenzellen mit Botenstoffen wie Dopamin, die Lust, Antrieb und Lernprozesse steuern. Genau diese Schaltkreise geraten bei einer Abhängigkeit aus dem Takt. Ein niedriger Vitamin-D-Spiegel könnte diesen Takt zusätzlich verformen.
Das Vitamin D bindet an seinen Rezeptor, den VDR, der in Nervenzellen und Gliazellen vorkommt. Über diesen Rezeptor werden Gene geschaltet, die an der Herstellung und dem Abbau von Botenstoffen beteiligt sind. Ist der Rezeptor zu wenig aktiviert, fehlen solche Korrekturimpulse. Die Folge kann eine höhere Empfindlichkeit für Suchtreize sein und ein Belohnungssystem, das schneller kippt.
Hinzu kommt, dass der VDR nicht bei allen Menschen gleich arbeitet. Kleine genetische Unterschiede können die Stärke des Signals verändern. Wer genetisch eine schwächere VDR-Aktivität hat und gleichzeitig niedrige Vitamin-D-Werte aufweist, könnte deshalb stärker gefährdet sein, dass Stress, Reizüberflutung oder Alkohol das Belohnungssystem dominieren. Das erklärt nicht jede Abhängigkeit, es liefert aber einen plausiblen biologischen Pfad, warum Vitamin-D-Mangel bei manchen Betroffenen den Druck in Richtung Konsum erhöhen oder die Widerstandskraft senken kann.
Vitamin D wirkt außerdem wie ein Moderator zwischen Nervenzellen und Immunzellen im Gehirn. Chronischer Alkoholkonsum fördert entzündliche Signale im Nervensystem. Vitamin D dämpft solche Prozesse normalerweise und unterstützt antioxidative Schutzmechanismen. Fehlt dieser Puffer, steigt die Entzündungsneigung. Entzündungen verändern wiederum die Dopaminsignale und die Stressachsen-Regulation.
Viele Betroffene kennen das als innere Unruhe, Reizbarkeit und das Gefühl, schnell überfordert oder getrieben zu sein. Ein stabiler Vitamin-D-Status kann diese Übererregung nicht heilen, er kann die Lage aber entkoppeln, indem er Entzündung bremst und die Reizverarbeitung stabilisiert.
Ein weiterer Baustein ist die Feinabstimmung des Kalziumsignals in Nervenzellen. Aktivierte Nervenzellen arbeiten mit kurzen Kalziumspitzen. Vitamin D reguliert Kanäle und Transporter, die diese Spitzen formen. Sind die Werte zu niedrig, läuft die Signalübertragung leichter aus dem Ruder. Das betrifft besonders Lernprozesse im Belohnungssystem, bei denen das Gehirn merkt, was sich lohnt. Genau dort entstehen die hartnäckigen Verknüpfungen zwischen Auslösern, Stimmung und Konsum. Stabilere Signale bedeuten nicht automatisch Abstinenz, sie erleichtern aber die Umgewöhnung, weil neue, nüchterne Belohnungsmuster besser gelernt werden.
Schließlich verbindet Vitamin D das Belohnungssystem mit Stimmung und Schlaf. Es beeinflusst Enzyme der Serotonin- und Noradrenalinbildung und wirkt auf die innere Uhr. Viele Rückfälle passieren in Phasen schlechter Stimmung, Erschöpfung oder winterlicher Antriebslosigkeit.
Hier kommt ein alltagsnaher Gedanke ins Spiel: Wer im Winterhalbjahr wenig Sonne bekommt, rutscht leichter in einen Mangel. In dieser Lage sind die Regelkreise labiler und der innere Widerstand schwächer. Das erklärt nicht jeden Rückfall, es beschreibt aber eine Situation, in der ein korrigierter Vitamin-D-Status die Ausgangslage verbessert.
Alkoholabhängigkeit und Vitamin-D-Mangel
Dass Alkohol auf Dauer die Leber, die Nerven und das Gehirn schädigt, ist bekannt. Weniger bekannt ist, wie stark Alkohol den Stoffwechsel von Vitaminen und Mineralstoffen stört – und dass darunter besonders häufig Vitamin D betroffen ist.
Menschen, die regelmäßig oder über längere Zeit trinken, haben in Studien deutlich niedrigere Vitamin-D-Spiegel als Vergleichspersonen. In einer Untersuchung lag bei fast zwei Dritteln der Betroffenen ein deutlicher Mangel vor. Das betrifft nicht nur schwer abhängige Menschen, sondern auch langjährige „Gewohnheitstrinker“.
Die Ursachen sind vielfältig:
• Leber und Darm können Vitamin D schlechter verarbeiten, weil Alkohol die Schleimhäute schädigt und Enzyme hemmt.
• Viele Betroffene verbringen weniger Zeit im Freien, wodurch die körpereigene Bildung durch Sonnenlicht sinkt.
• Hinzu kommt eine einseitige Ernährung, die meist arm an Nährstoffen ist.
• Und schließlich wirkt Leberverfettung oder –zirrhose wie ein Puffer, der das Vitamin im Gewebe bindet, ohne dass es im Blut ankommt.
Ein Vitamin-D-Mangel bleibt lange unbemerkt. Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Stimmungsschwankungen oder Muskelschmerzen werden leicht dem Alkoholentzug oder der psychischen Belastung zugeschrieben. Dabei kann genau dieser Mangel die Schwankungen im Befinden noch verstärken.
Forscher vermuten zudem, dass Vitamin D direkt in das Belohnungssystem eingreift – also in jene Hirnstrukturen, die Alkohol zunächst angenehm und entspannend wirken lassen. Fehlt Vitamin D, reagieren diese Systeme empfindlicher auf künstliche Reize. Das könnte erklären, warum manche Menschen nach längerer Abstinenz wieder rückfällig werden, wenn sie müde, antriebslos oder im Winterhalbjahr depressiv gestimmt sind.
Ob die Gabe von Vitamin D das Rückfallrisiko tatsächlich senken kann, ist noch nicht bewiesen. Aber es spricht vieles dafür, den Spiegel regelmäßig kontrollieren zu lassen. Denn unabhängig von jeder Suchttherapie stabilisiert ein ausgeglichener Vitamin-D-Status das Immunsystem, den Muskelstoffwechsel und die Stimmung – alles Faktoren, die den Weg aus der Abhängigkeit erleichtern können.
Vitamin D und Opioidabhängigkeit
Auch bei Patientinnen und Patienten mit Opioidabhängigkeit zeigen sich ähnliche Befunde: In einer norwegischen Studie hatten fast alle untersuchten Betroffenen einen Vitamin-D-Mangel, der selbst im Verlauf einer medikamentösen Erhaltungstherapie bestehen blieb. Das wirft die Frage auf, ob eine gezielte Substitution hier positive Effekte haben könnte – etwa auf Stimmung, Schlaf oder Rückfallneigung.
Eine experimentelle Arbeit mit Tiermodellen liefert dazu einen interessanten Hinweis: Tiere mit Vitamin-D-Mangel entwickelten eine deutlich stärkere Abhängigkeit vom Opioid-Effekt, sowohl bei Schmerzmitteln als auch bei UV-Licht, das endogene Endorphine freisetzt. Vitamin-D-Rezeptoren scheinen also an der Steuerung des körpereigenen Belohnungssystems beteiligt zu sein.
Wer nun denkt, dass das nur Süchtigen im eher lichtarmen Norwegen passiert – falsch vermutet. Auch in Süditalien, wo Sonne keine Mangelware ist, fand man in einer Studie aus Neapel einen ausgeprägten Vitamin-D-Mangel bei alkoholabhängigen Patienten. Selbst dort, wo die UV-Strahlung fast ganzjährig ausreicht, lagen die Werte vieler Betroffener im Bereich eines schweren Mangels. Die Autoren führen das auf Lebererkrankungen, Mangelernährung und eingeschränkte Umwandlung in der Leber zurück – nicht aber auf fehlende Sonne.
In einer kleinen, aber gut kontrollierten Studie mit Menschen, die sich unter Methadon-Erhaltungstherapie befanden, erhielten Teilnehmer alle zwei Wochen hochdosiertes Vitamin D. Nach sechs Monaten zeigten sie eine bessere Stimmung und Konzentration als die Placebo-Gruppe. Zwar wurde die Rückfallrate in dieser Studie nicht untersucht, doch die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Vitamin D zumindest begleitend zur Stabilisierung beitragen kann.
Vitamin D-Kontrolle sollte in der Suchtmedizin Standard werden
Noch ist unsicher, ob Vitamin D tatsächlich Suchtverhalten beeinflusst – oder ob es nur ein Begleitfaktor schlechter Ernährung und fehlender Sonne ist. Sicher ist aber: Menschen mit Suchterkrankungen weisen häufig einen Vitamin-D-Mangel auf, und dessen Ausgleich kann den Körper in vielerlei Hinsicht stärken.
Bis mehr Studien zu Rückfallraten und Entzugsverläufen vorliegen, bleibt Vitamin D ein unterstützender, aber kein therapeutischer Faktor. Dennoch sollte die Kontrolle des Vitamin-D-Spiegels in der Suchtmedizin künftig einen festen Platz bekommen – als einfach überprüfbarer Marker und potenziell hilfreicher Baustein einer ganzheitlichen Behandlung.
Wie komme ich auf einen ausreichend hohen Vitamin-D-Spiegel?
Ein guter Vitamin-D-Spiegel liegt nach aktuellem internationalen Standard zwischen 50 und 70 ng/ml (125–175 nmol/l). Das ist der Bereich, in dem sich in Studien die besten Werte für Immunfunktion, Stimmung und Stoffwechsel zeigen. Die deutschen Referenzwerte (oft 20–30 ng/ml) gelten heute als veraltet und zu niedrig angesetzt. Aber das ändert sich vielerorts auch schon.
Um diesen Bereich zu erreichen, gibt es zwei Wege: Sonne und Ernährung – oder, wenn das nicht reicht, gezielte Substitution. Oder beides, auch abgestimmt nach Jahreszeit.
Natürliche Quellen – Sonne
Der Körper kann Vitamin D selbst bilden, wenn Sonnenlicht direkt auf die Haut trifft. Entscheidend ist die UV-B-Strahlung, die zwischen April und September am Mittag am stärksten ist. Wer täglich etwa 20 bis 30 Minuten mit unbedeckten Armen und Gesicht in die Sonne geht (ohne Sonnenschutzmittel), kann – abhängig von Hauttyp und Jahreszeit – 2.000 bis 5.000 IE Vitamin D bilden.
Die körpereigene Bildung hängt stark vom Sonnenstand ab. Entscheidend ist die UV-B-Strahlung, und die erreicht Mitteleuropa nur dann, wenn die Sonne höher als etwa 45 Grad über dem Horizont steht. Das ist in unseren Breiten nur zwischen April und September der Fall – und auch dann nur um die Mittagszeit. In den übrigen Monaten fällt der Einfallswinkel so flach, dass die UV-B-Anteile fast vollständig von der Atmosphäre herausgefiltert werden.
Selbst an einem sonnigen Wintertag auf der Skipiste oder bei klarer Bergluft entsteht deshalb kein nennenswerter Vitamin-D-Effekt: Das Licht enthält dort zwar reichlich UV-A, das die Haut bräunt und altert, aber kaum UV-B, das für die Vitamin-D-Synthese nötig wäre.
Wirklich ausreichend UV-B-Strahlung gibt es ganzjährig nur südlich des 35. Breitengrades – also etwa ab Nordafrika, südlich von Sizilien oder der Insel Kreta. Nördlich davon steht die Sonne in den Wintermonaten zu tief. Wer also im deutschsprachigen Raum oder im nördlichen Mittelmeerraum lebt, kann den Vitamin-D-Speicher im Winter nicht durch Sonne auffüllen, sondern höchstens von den Sommerreserven zehren.
Natürliche Quellen – Ernährung
Über die Ernährung allein ist es dagegen kaum möglich, einen stabilen Spiegel zu erreichen. Ein Erwachsener benötigt – abhängig von Körpergewicht, Jahreszeit und Hauttyp – im Durchschnitt 2.000 bis 4.000 IE Vitamin D pro Tag, um einen Blutwert im optimalen Bereich (50–70 ng/ml) zu halten. Zum Vergleich:
- 100 g Lachs oder Hering enthalten rund 600–800 IE.
- Um auf 4.000 IE zu kommen, müsste man also etwa 500–700 g fetten Fisch pro Tag essen – was weder praktisch noch empfehlenswert ist.
- Eier, Butter oder Milch tragen nur geringfügig bei.
Selbst wer sich ausgewogen ernährt, bleibt deshalb in unseren Breiten ab Herbst meist unterversorgt. Ein Bluttest beim Arzt (25-OH-Vitamin D) zeigt, wie stark der Mangel ist und ob eine Ergänzung nötig ist.
Substitution / Nahrungsergänzung
Zur gezielten Anhebung des Spiegels kann Vitamin D3 in Tropfen- oder Kapselform eingenommen werden. Die Aufnahme über den Darm hängt stark von Fettzufuhr, Gallensäuren und individueller Genetik ab – man spricht von einer Resorptionsrate zwischen 60 und 90 Prozent.
Als Faustregel gilt: 1.000 IE (25 µg) Vitamin D3 pro Tag erhöhen den Blutspiegel eines Erwachsenen im Durchschnitt um etwa 1 ng/ml – bei optimaler Aufnahme. Das bedeutet:
- Wer von 20 auf 60 ng/ml kommen will, benötigt über Wochen oder Monate rund 40.000 IE pro Woche, also etwa 6.000 IE pro Tag.
- Danach genügt meist eine Erhaltungsdosis von 2.000–4.000 IE täglich, um den Spiegel zu halten.
Personen mit starkem Übergewicht, Leber- oder Darmerkrankungen benötigen oft höhere Dosierungen, da Vitamin D im Fettgewebe gespeichert wird. Am sichersten ist es, die Werte regelmäßig zu kontrollieren – idealerweise im Spätherbst (niedrigster Punkt) und im Frühjahr (nach Supplementation).
Vitamin D: Viel hilft nicht viel
Vitamin D ist fettlöslich und wird im Körper gespeichert. Eine dauerhafte Überdosierung kann den Kalziumspiegel im Blut zu stark ansteigen lassen, was langfristig die Nieren belastet und zu Verkalkungen in Gefäßen oder Gewebe führen kann.
Als sicher gelten tägliche Mengen bis etwa 4.000 IE bei Erwachsenen. Höhere Dosen ja, wenn medizinisch erforderlich, aber unter Labor- und ärztlicher Kontrolle erfolgen, wenn ein Mangel nachgewiesen ist.
Warum ist mein Arzt sehr vorsichtig?
Vitamin D wurde 1922 vom amerikanischen Biochemiker Elmer McCollum entdeckt – auf der Suche nach den Ursachen der Rachitis, einer früher häufigen Erkrankung bei Kindern, bei denen die Knochen sich massiv verformten.
Die Rachitis bei Kindern wurde durch zugeführtes Vitamin D damit schnell und nachhaltig beseitigt – und natürlich kamen Ärzte damals auf die Idee zu testen, bei welchen Erkrankungen man damit noch helfen konnte. Sie fanden beispielsweise heraus, dass sich Asthma oder multiple Sklerose mit hohen Dosierungen bessern ließen. Gleichzeitig zeigte sich aber, dass die Dosierungen nicht beliebig steigerbar waren.
Schwere Nierenschäden durch Kalziumablagerungen waren schon schlimm genug – aber noch einschneidender war die zwar extrem seltene, aber potentiell tödliche, durch Überdosierung ausgelösten „paradoxe Tetanie“. Sie beginnt mit schmerzhaften Muskelverkrampfungen und kann – wenn sie unbehandelt bleibt – auch Atemmuskulatur und Stimmritzenmuskulatur betreffen. In der Folge drohen Atemnot, Herzrhythmusstörungen, Kammerflimmern oder Herzstillstand.
Wie gesagt sehr selten, aber gefährlich – und aus der Zeit stammt eine weitverbreitete Skepsis unter Ärzten über hochdosiertes Vitamin D. Man verließ die Versuche komplett, durch hohe Dosierungen von Vitamin D bestimmte Krankheiten anzugehen. Den Punkt, an dem Vitamin D zu viel wird, kann man aber bis heute nicht exakt benennen. Die kritischen Werte stammen aus Einzelfallberichten und Sicherheitsabschätzungen – nicht aus gezielten Studien, denn niemand dürfte Menschen absichtlich in eine gefährliche Überdosierung bringen.
Was man weiß: Der Vitamin-D-Spiegel allein entscheidet nicht über eine Vergiftung. Entscheidend ist, wie gut der Körper Kalzium und das aktive Hormon Calcitriol regulieren kann. Solange die Nierenfunktion intakt ist, das Parathormon niedrig bleibt und keine übermäßige Kalziumzufuhr erfolgt, können auch hohe Werte zeitweise toleriert werden.
Therapien mit sehr hohen Dosierungen – wie das Coimbra-Protokoll, das bei Autoimmunerkrankungen wie Multipler Sklerose von spezialisierten Ärzten angewendet wird – bewegen sich bewusst in diesem Bereich, allerdings unter enger ärztlicher Kontrolle mit engmaschigen Blutuntersuchungen, um potentiell gefährliche Abweichungen rechtzeitig zu entdecken, bevor sie das System aus dem Gleichgewicht bringen.
Genug gegruselt. Zusammengefasst seid ihr mit Werten zwischen 50 und 70 ng/ml (125–175 nmol/l nach internationalem Standard auf der sicheren Seite.

FAQ – häufig gestellte Fragen
Hilft Vitamin D gegen Alkoholsucht oder andere Abhängigkeiten?
Vitamin D kann eine Abhängigkeit nicht heilen, aber es unterstützt Körper und Gehirn bei der Stabilisierung des Belohnungssystems. Ein Mangel verstärkt nachweislich Stimmungsschwankungen, Müdigkeit und Stress – Faktoren, die Rückfälle bei Alkoholabhängigkeit oder anderen Süchten begünstigen können. Eine ausreichende Versorgung kann daher ein Baustein zur Rückfallprophylaxe sein, ersetzt aber keine Therapie.
Internationale Leitlinien empfehlen Serumwerte zwischen 50 und 70 ng/ml (125–175 nmol/l). Unter 20 ng/ml spricht man von einem deutlichen Mangel, unter 10 ng/ml drohen Muskelkrämpfe oder Tetanie. Bei Suchterkrankungen kann eine ausreichende Versorgung den Stoffwechsel und die Nervenfunktion stabilisieren.Welche Vitamin-D-Werte gelten als optimal für Gesundheit und Suchtprävention?
Je nach Ausgangswert dauert es etwa 8 bis 12 Wochen, um einen stabilen Spiegel zu erreichen. Bei täglicher Einnahme von 4 000 – 6 000 IE Vitamin D oder zwei Kapseln à 20 000 IE pro Woche beispielsweise steigt der Spiegel meist zuverlässig. Anschließend genügt meist eine Erhaltungsdosis von 2 000 – 4 000 IE täglich. Eine Kontrolle nach etwa 10 Wochen zeigt, ob die Dosis passt.Wie schnell lässt sich ein Vitamin-D-Mangel ausgleichen?
In Mitteleuropa nur zwischen April und September, wenn die Sonne mittags hoch genug steht. Im Winter fällt die UV-B-Strahlung zu flach ein, selbst auf der Skipiste. Sonne hinter Fenstern hilft ebenfalls nicht. Wer nördlich von Sizilien lebt, sollte bei Bedarf im Winter auf Nahrungsergänzung oder ärztlich kontrollierte Supplementation zurückgreifen.Kann ich genug Vitamin D durch Sonne bilden – auch im Winter?
Am besten durch eine Blutuntersuchung des 25-OH-Vitamin-D-Wertes. Der Test kann beim Hausarzt oder im Labor erfolgen und kostet privat etwa 25 – 35 Euro. Ideal ist eine Kontrolle im Spätherbst und nach 8 – 12 Wochen Supplementierung. So lässt sich vermeiden, dass der Vitamin-D-Spiegel zu niedrig bleibt oder eine Überdosierung entsteht.Wie prüfe ich meinen Vitamin-D-Spiegel und wann ist das sinnvoll?
-
Putative role of vitamin D in the mechanism of alcoholism and other addictions – a hypothesis (2020/2021)
Hypothesenarbeit: Beschreibt, wie ein niedriger Vitamin-D-Spiegel das dopaminerge Belohnungssystem beeinflussen könnte; diskutiert genetische Varianten des Vitamin-D-Rezeptors (VDR).
PubMed · Cambridge -
Vitamin D deficiency exacerbates UV/endorphin and opioid addiction (Science Advances, 2021)
Tier + Human: Vitamin-D-Mangel verstärkte im Tiermodell die Opioid- und UV-Abhängigkeit; beim Menschen inverse Beziehung zwischen 25-OH-D-Spiegel und Opioidgebrauch.
PubMed -
Vitamin D status and associations with substance use patterns among people with severe SUD (Scientific Reports, 2022)
Kohortenstudie (Norwegen): Hohe Prävalenz von Vitamin-D-Mangel bei Opioid- und Suchtpatienten; Mangel blieb über den gesamten Verlauf bestehen.
PubMed · Nature -
Vitamin D deficiency in alcohol-use disorders (Nepal, 2013)
Querschnittsstudie: Rund 90 % der Patienten mit Alkoholabhängigkeit unzureichend, 64 % mit klarem Mangel; Zusammenhang mit Schweregrad und Komorbidität.
PubMed -
Exploring the Effects of Vitamin D Supplementation under Methadone Maintenance (RCT, 2019/2020)
Randomisiert, Placebo-kontrolliert: 50 000 IE alle zwei Wochen über 24 Wochen; verbesserte Kognition und Stimmung, keine Rückfall-Daten.
PubMed -
Vitamin D and alcohol: A review of the current literature (2017)
Review (49 Studien): Uneinheitliche Ergebnisse – einige positive, andere neutrale oder negative Zusammenhänge; methodische Unterschiede groß.
PubMed · ScienceDirect -
Vitamin D Deficiency Is Associated with Advanced Liver Fibrosis in Alcohol-Use Disorder (Nutrients, 2024)
Klinische AUD-Kohorte: Sehr häufige Vitamin-D-Defizienz; Zusammenhang mit fortgeschrittener Leberfibrose und gestörtem Glukosestoffwechsel.
PubMed · MDPI -
Potential roles for vitamin D in preventing and treating impulse control disorders (Scoping Review, 2024)
Übersichtsarbeit: Diskutiert Vitamin-D-Beteiligung an Impulskontrolle und Belohnungssystem; mögliche Schnittstellen zu Suchterkrankungen.
ScienceDirect
Weitere Beiträge in unserem Blog
- Abstinenz war für mich kein großer, heroischer Schritt
- Der Schlüssel zum Glück steckt von innen
- Hirnschäden bei Alkoholikern durch Vitaminmangel: Eine oft übersehene Gefahr
- Frisch abstinent und auf der Gefühls-Achterbahn
- Benzodiazepine im Entzug: Pille statt Pulle?
- Nein ist ein vollständiger Satz!
- Histamin, Alkohol und Herzrhythmus: Warum Wein so oft Herzrasen und Unruhe auslöst
- Unglücklich trocken? Das muss nicht sein!
- Wie Alkohol zunächst Angstzustände lindert – später aber Panikattacken und Hangxiety auslöst
- Video-Blog: Dry January– mehr Veränderung, als viele erwarten

Dr. med. Bernd Guzek
Arzt, Autor, Angehöriger & Mitbegründer von Alkohol adé
Beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den biochemischen Grundlagen von Sucht und Hirnstoffwechselstörungen sowie deren Beeinflussung durch Nährstoffe.