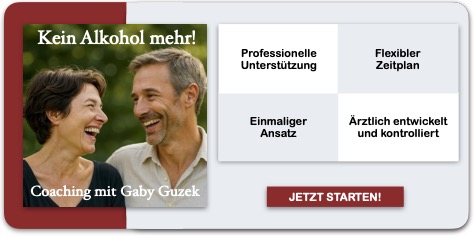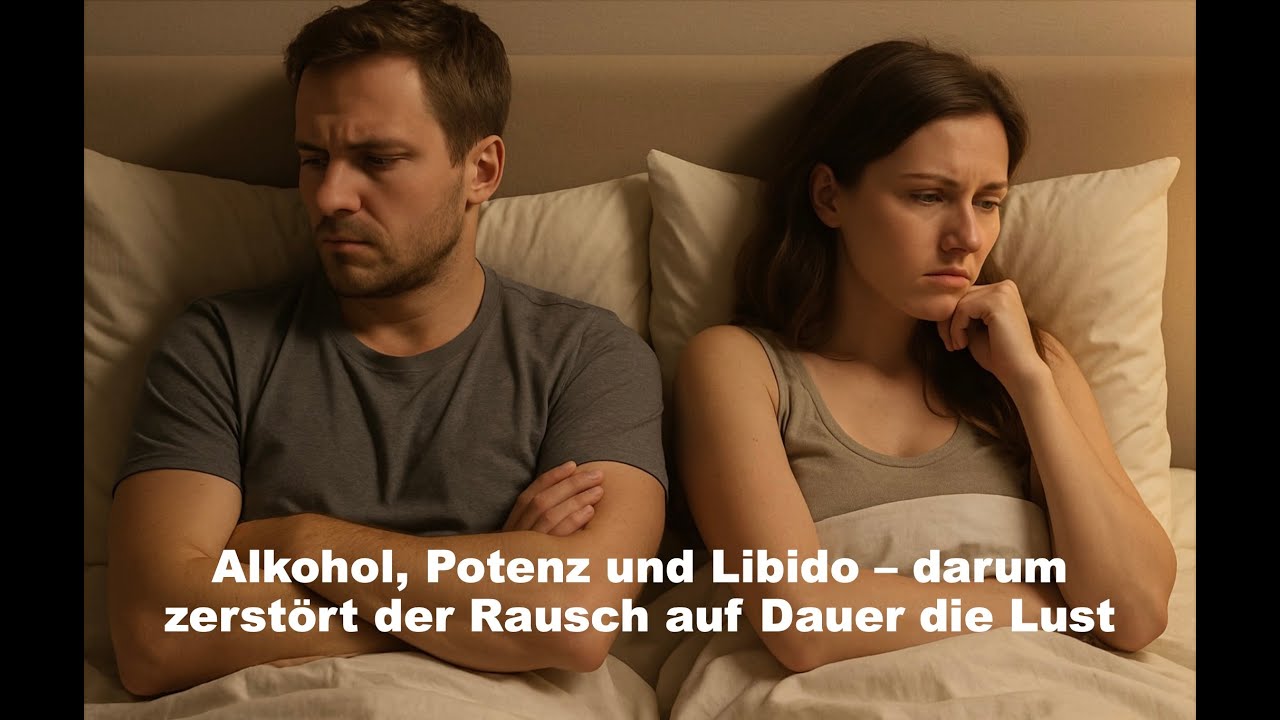Der Shakespeare-Effekt

„Wine provokes the desire, but it takes away the performance.“
„Wein weckt das Verlangen, doch er nimmt die Fähigkeit.“
William Shakespeare, Macbeth, Akt 2, Szene 3
Der Satz stammt aus der berühmten „Porter Scene“. Schon Shakespeare erkannte, was die Medizin heute exakt erklären kann: Alkohol stimuliert das Verlangen, hemmt aber die Fähigkeit – sowohl körperlich als auch psychisch.
Shakespeare spielt damit auf die paradoxe Wirkung an: Alkohol verführt durch Enthemmung, verhindert aber zugleich die körperliche Umsetzung.
Von Dr. med. Bernd Guzek
So verändert Alkohol die Steuerung der Sexualität
Sexuelle Lust und Potenz beruhen auf einem fein abgestimmten Zusammenspiel aus Nervenbotenstoffen, Hormonen und Gefäßreaktionen. Alkohol greift in alle diese Systeme ein – mit weitreichenden Folgen für Libido und Erregungsfähigkeit.
Zentralnervöse Wirkungen
Alkohol verändert das Gleichgewicht der wichtigsten Neurotransmitter im Gehirn. Er verstärkt die Wirkung des hemmenden GABA und blockiert gleichzeitig die anregenden NMDA-Rezeptoren für Glutamat. Das beruhigt zwar und senkt Hemmungen, dämpft aber auch die neuronale Erregbarkeit. Reflexe verlangsamen sich, die körperliche Reaktionsfähigkeit lässt nach – auch sexuell.
Zunächst stimuliert Alkohol das Dopaminsystem im Belohnungszentrum des Gehirns. Dadurch fühlt man sich gelöst, gesellig und emotional offener. Doch bei regelmäßigem Konsum sinkt die Zahl der Dopaminrezeptoren (D2), das System stumpft ab. Die Folge ist ein Mangel an Antrieb, Motivation und sexueller Energie.
Hinzu kommt die Wirkung auf das Serotoninsystem. Alkohol erhöht kurzfristig den Serotoninspiegel über die 5-HT₃-Rezeptoren, was zunächst beruhigt oder euphorisiert. Bei wiederholtem Trinken gerät das System aber aus der Balance, die Stimmung kippt. Es entsteht eine Anhedonie – der Verlust der Fähigkeit, Freude und Lust zu empfinden. Damit verschwindet genau das, was Alkohol anfangs vorgaukelt: Nähe, Begeisterung und Lebendigkeit.
Die hormonelle Steuerzentrale: Hypothalamus, Hypophyse und Geschlechtsdrüsen
Die Sexualhormone werden über eine empfindliche Achse zwischen Gehirn und Geschlechtsorganen gesteuert – die hypothalamisch-hypophysär-gonadale Achse. Im Hypothalamus wird GnRH freigesetzt, das in der Hypophyse die Bildung von LH und FSH anregt. Diese Hormone steuern in Hoden und Eierstöcken die Produktion von Testosteron und Estradiol.
Alkohol unterbricht diesen Regelkreis. Er hemmt die GnRH-Freisetzung, senkt LH und FSH, und dadurch die Hormonproduktion in den Gonaden. Der Testosteron- und Estradiolspiegel fällt ab – mit spürbaren Folgen für Lust, Energie und Stimmung.
Weiterlesen: Alkoholentzug | Fettleber | Leberzirrhose | Anhedonie |
Gleichzeitig steigt der Spiegel des Hormons Prolaktin, das die Libido bremst. Verstärkend kommen erhöhte Endorphine hinzu: Sie vermitteln Entspannung, hemmen aber ebenfalls die GnRH-Ausschüttung. So entsteht eine doppelte hormonelle Bremse – weniger Antrieb, weniger Lust und auf Dauer eine verringerte Fruchtbarkeit.
Die körperliche Seite: Durchblutung, Gefäße und Stoffwechsel
Auch im Körper selbst hemmt Alkohol die physiologischen Mechanismen, die sexuelle Erregung ermöglichen. Eine Erektion oder die weibliche Lubrikation beruhen auf einer feinen Gefäßreaktion, vermittelt durch das Gas Stickstoffmonoxid (NO). Es wird von der eNOS-Synthase in den Endothelzellen gebildet und sorgt für die Entspannung der glatten Muskulatur, damit Blut einströmen kann.
Alkohol hemmt diese NO-Bildung, schädigt die Endothelzellen und erzeugt beim Abbau das giftige Acetaldehyd, das die Gefäße verengt. Dadurch sinkt die Durchblutung im Genitalbereich, und die körperliche Erregung wird schwächer oder bleibt aus.
Bei längerem Konsum verändert sich zusätzlich der Hormontransport: Die Leber bildet vermehrt Sexualhormon-bindendes Globulin (SHBG), das Testosteron und Estradiol bindet und biologisch unwirksam macht. Selbst normale Laborwerte können dann eine Mangelwirkung verschleiern. Ergebnis: Potenzschwäche, Antriebslosigkeit, Libidoverlust.
Hormonelles Chaos nach der Euphorie
Nach der kurzen Phase der Enthemmung fällt das System in sich zusammen. Die Dopaminrezeptoren reagieren träge, der Belohnungsreiz versiegt. Gleichzeitig steigen die Spiegel von Cortisol, dem Stresshormon, das Testosteron und Estradiol weiter unterdrückt. Der Serotoninspiegel sinkt – das Gehirn verliert seine Balance.
Diese Kombination führt zu einem Zustand dauernder Erschöpfung und innerer Leere. Freude, Sinnlichkeit und Nähe verschwinden. In der Medizin spricht man von Anhedonie – dem Verlust der Fähigkeit, Lust oder Freude zu empfinden. Alkohol, der zunächst Offenheit und Selbstvertrauen suggerierte, wird nun zum Verstärker von Distanz, Gereiztheit und Einsamkeit.
Regeneration nach Abstinenz
Die gute Nachricht: Der Körper kann sich erstaunlich gut erholen. Schon nach wenigen Wochen stabilisiert sich das Dopaminsystem, Cortisol sinkt, und die Stimmung hellt sich auf. Nach etwa drei Monaten steigen LH, FSH und Testosteron deutlich an, Prolaktin normalisiert sich. Die Libido kehrt zurück, Energie und Tatkraft nehmen zu.
- Nach 2–4 Wochen: Dopaminspiegel stabilisieren sich, Cortisol sinkt.
- Nach 3 Monaten: LH, FSH und Testosteron steigen messbar.
- Nach 6 Monaten: Die Endothelfunktion (NO-Bildung) regeneriert sich, Erektion und Libido normalisieren sich häufig vollständig.
- Frauen: berichten über klarere Wahrnehmung, stabilere Stimmung und wiederkehrende Lust.
Nach sechs Monaten sind auch die Gefäße wieder besser durchblutet. Die Stickstoffmonoxid-Produktion nimmt zu, die Endothelfunktion regeneriert sich, und die sexuelle Reaktionsfähigkeit kehrt meist vollständig zurück. Viele berichten in dieser Phase von einer neuen, ruhigeren Form von Lust – weniger triebhaft, dafür bewusster und emotionaler.
Langjährige Trinker benötigen manchmal mehr Zeit, besonders bei Leberschäden oder hormoneller Erschöpfung. Doch fast immer zeigt sich: Mit jedem nüchternen Monat wächst die Lebensfreude – und mit ihr die Fähigkeit, Nähe und körperliche Erregung wieder wirklich zu empfinden.
Nach einem Alkoholstopp kann die Libido zunächst schwanken. Das ist Teil der hormonellen Erholung. Wenn die sexuelle Lust über Monate ausbleibt oder sich depressive Symptome zeigen, sollte eine ärztliche Abklärung erfolgen – insbesondere von Testosteron, Estradiol, Prolaktin und Cortisol.
FAQ – häufig gestellte Fragen
Welche Neurotransmitter beeinflusst Alkohol in Bezug auf Sexualität?
Vor allem GABA, Glutamat, Dopamin und Serotonin. Alkohol verstärkt GABA, hemmt Glutamat, erhöht kurzfristig Dopamin und Serotonin – langfristig führt das zu einem Ungleichgewicht, das Lust und Motivation dämpft.
Alkohol hemmt die GnRH-Ausschüttung im Hypothalamus. Dadurch werden weniger LH und FSH gebildet, was die Testosteron- und Estradiolproduktion senkt. Gleichzeitig steigt Prolaktin, das die Libido bremst.Wie beeinträchtigt Alkohol die Hormonproduktion?
Alkohol reduziert die Stickstoffmonoxid-Produktion und schädigt die Gefäßwände. Dadurch ist die Erweiterung der Schwellkörper gestört – ein zentraler Mechanismus der erektilen Dysfunktion.Was passiert mit der Durchblutung im Genitalbereich?
Viele Systeme stabilisieren sich nach wenigen Wochen. Eine vollständige Normalisierung von Hormonen und Gefäßreaktionen kann jedoch bis zu sechs Monate dauern – abhängig von Dauer und Ausmaß des Konsums.Wie lange dauert die Erholung nach dem Entzug?
Weitere Beiträge in unserem Blog
- Der Schlüssel zum Glück steckt von innen
- Hirnschäden bei Alkoholikern durch Vitaminmangel: Eine oft übersehene Gefahr
- Frisch abstinent und auf der Gefühls-Achterbahn
- Benzodiazepine im Entzug: Pille statt Pulle?
- Nein ist ein vollständiger Satz!
- Histamin, Alkohol und Herzrhythmus: Warum Wein so oft Herzrasen und Unruhe auslöst
- Unglücklich trocken? Das muss nicht sein!
- Wie Alkohol zunächst Angstzustände lindert – später aber Panikattacken und Hangxiety auslöst
- Video-Blog: Dry January– mehr Veränderung, als viele erwarten
- Holiday-Heart-Syndrom: Wenn Alkohol Deinen Herzschlag zur Rave-Party macht

Dr. med. Bernd Guzek
Arzt, Autor, Angehöriger & Mitbegründer von Alkohol adé
Beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den biochemischen Grundlagen von Sucht und Hirnstoffwechselstörungen sowie deren Beeinflussung durch Nährstoffe.