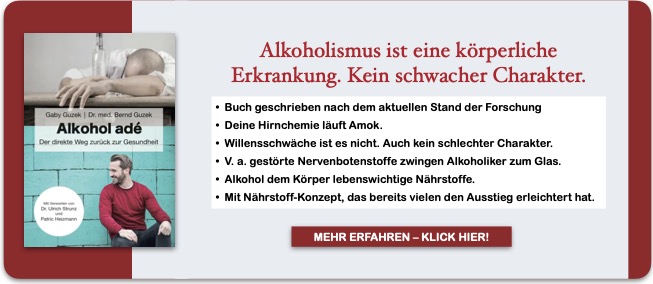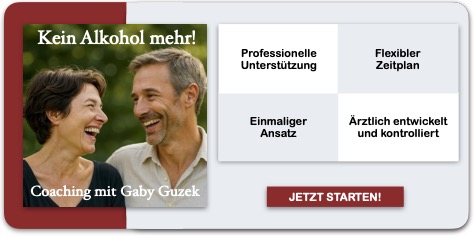Wer ein ausgewogenes GABA- und Glutamatsystem hat, der kann sich gut konzentrieren, ist aufmerksam und hellwach – kann sich danach aber genauso wieder beruhigt entspannen. Schwierig wird es aber, wenn aus irgendeinem Grund die beiden aus der Balance geraten. Dafür gibt es viele Gründe – einer der wichtigsten davon ist Alkohol.
Von Dr. med. Bernd Guzek
GABA und Glutamat – das Brems- und Gaspedal im Gehirn
Hört sich merkwürdig an, ist aber so: Entspannung in unserem Körper ist reine Chemie. Zuständig dafür sind die Neurotransmitter, unsere Nervenbotenstoffe. Ob wir mehr aufgeregt oder eher ruhig sind, regeln vor allem zwei dieser Neurotransmitter: Glutamat und GABA. Gamma-Amino-Butyric-Acid oder auf Deutsch Gamma-Amino-Buttersäure – muss sich niemand merken, GABA reicht. GABA macht ruhig – sein natürlicher Gegenspieler heißt Glutamat. Mit dem Geschmacksverstärker Glutamat aus der asiatischen Küche hat Glutamat in unserem Körper aber nichts zu tun, das ist eine unglückliche Namensgleichheit.
GABA und Glutamat sind wie Ebbe und Flut oder Yin und Yang. Während GABA bremst, drückt Glutamat aufs Gaspedal. Betritt Glutamat die Bühne, steht unser Nervenkostüm auf „Alarm!“. Bewegung, Aufmerksamkeit, Wachsamkeit, Konzentration. Das ist Glutamat-Revier.
GABA dagegen reduziert Angst und Stress. Es drosselt Stressreaktionen und spielt eine zentrale Rolle dabei, Angstzuständen zu vermeiden. Medikamente wie Benzodiazepine (z. B. Diazepam, Markenname das allseits bekannte Valium) werden zur Behandlung von Angststörungen oder im Alkoholentzug eingesetzt, weil sie die Wirkung vom GABA am Rezeptor verstärken.
Wie GABA im Körper wirkt – und warum Alkohol daran andockt
Wer ein ausgewogenes GABA- und Glutamatsystem hat, der kann sich gut konzentrieren, ist aufmerksam und hellwach – kann sich danach aber genauso wieder beruhigt entspannen. Schwierig wird es aber, wenn aus irgendeinem Grund die beiden aus der Balance geraten. Dafür gibt es viele Gründe – einer der wichtigsten davon ist Alkohol.
Alkoholismus ist eng mit einem gestörten GABA-Glutamat-System verbunden. Alkohol stört die Balance der beiden Neurotransmitter. Er dockt an GABA-Rezeptoren an und verhindert, dass Glutamat wirken kann. Der Körper regelt dagegen – und genau das stellt die Weichen in Richtung Abhängigkeit.
Alkohol als GABA-Ersatz – warum das so gefährlich ist
Wir alle kennen das berühmte „Entspannungsglas“ nach einem hektischen Tag oder weil man sich daran gewöhnt hat. Also Alkohol. Alkohol ist chemisch gesehen nichts anderes als ein GABA-Ersatz. Er hat eine sehr interessante Eigenschaft: Er passt an die Nerven-Andockstelle, die eigentlich ausschließlich für GABA reserviert ist. Medizinisch gesprochen: Alkohol passt an den GABA-Rezeptor. Auch wenn es dort überhaupt nichts zu suchen hat.
Beim Suchtausstieg spielt GABA dann eine zentrale Rolle. Es mindert Entzugssymptome, reduziert Cravings und Unruhe und stabilisiert das Nervensystem. Zwar finden sich einige GABA-Variationen, an denen Pharmakologen am GABA-Molekül herumgeschraubt haben. Die reine natürliche Substanz GABA findet sich dagegen eher im Selbsthilfebereich, nicht in den Kliniken. Das liege zum einen darauf, dass man mit der natürlichen Substanz weniger verdienen kann, lästern Kritiker – andere sagen, dass eben so das Kontrollsystem der Blut-Hirn-Schranke ausgetrickst werden kann. Aber die offizielle Lehrmeinung ist: GABA geht nicht durch die Blut-Hirn-Schranke.
GABA und die Blut-Hirn-Schranke: Was stimmt wirklich?
Die Blut-Hirn-Schranke ist ein sehr sinnvolles, körpereigenes Pförtnersystem. Es wacht darüber, welche chemischen Verbindungen ins Gehirn gelangen. Sie trennt die empfindlichen Nervenzellen des Gehirns vom übrigen Körper und passt scharf auf, wer rein darf und wer nicht. Dass einer der wichtigsten Nervenbotenstoffe zu den Nerven des Gehirns nicht durch darf, beruht auf einer eigentlich guten wissenschaftlichen Veröffentlichung von 1950, die immer wieder wiederholt wird.
Auch wenn die klassische Lehrmeinung GABA den Zugang zum Gehirn abspricht, mehren sich Hinweise auf spezielle Transportmechanismen an der Blut-Hirn-Schranke. Diese Forschung steht jedoch noch am Anfang und wird bislang kaum berücksichtigt.
Dass mehrere Forschergruppen mittlerweile GABA-Transporter-System an der Blut-Hirn-Schranke gefunden haben, die faszinierenderweise selbstregulierend sind und nur eine bestimmte Menge GABA durchlassen, schlägt sich bislang weder in den medizinischen Lehrbüchern noch auf Google oder KI-Systemen nieder. Das kann halt noch dauern. Die Verbreitung von Wissen in der Medizin bleibt halt ein zähes Geschäft – es dauerte beispielsweise fast 300 Jahre, bis die Erkenntnis, dass Vitamin C Skorbut verhindert, sich durchgesetzt hatte. Aber dazu an anderer Stelle mehr.
Selbstregulierend ist deshalb wichtig, weil ein Übermaß an GABA die Ruhe auch übertreiben und den Körper in Narkose versetzen könnte. Was für das Überleben der Art in der Evolution ziemlich gefährlich gewesen wäre.
GABA wirkt auch über den Darm – der andere Weg ins Gehirn
Aber selbst wenn die Transportersysteme noch nicht gefunden worden wären, wäre das nicht spielentscheidend. GABA entfaltet eine elegante Fernwirkung über das Nervengeflecht im Verdauungstrakt – ein alternativer Wirkweg bei oraler Einnahme als Nahrungsergänzung. Das Hirn funkt ja nicht nur an den Körper – auch in die entgegengesetzte Richtung läuft ein intensiver Datenverkehr.
GABA wird im Dünndarm in den Körper aufgenommen, gelangt von dort in die Blutbahn und kann ab da an den Nerven wirken. Damit geht dann das Entspannungssignal nicht in Richtung „Hirn-Körper“, sondern „Körper-Hirn“. Ein Nerv, der mit dem frisch aufgenommenen GABA in Kontakt kommt, entspannt sich. Und gibt die Info an den nächsten Nerven weiter, bis die Information über die Nervenkette oben im Gehirn angekommen ist, ohne dass das ursprüngliche, geschluckte GABA-Molekül selbst ins Gehirn wandern musste.
Soweit zur wichtigen Erklärung, warum an der Beobachtung vieler Alkoholiker im Entzug mehr dran sein könnte, dass GABA ihnen hilft und sie weniger oder gar keine Medikamente wie Diazepam brauchen, die selbst ja auch eine ausgeprägte Suchtgefahr haben.
Dass Vitamin C Skorbut verhindert, war bereits im 18. Jahrhundert bekannt – offiziell anerkannt und flächendeckend umgesetzt wurde diese Erkenntnis aber erst um 1930.
Was Alkohol mit GABA und Glutamat wirklich anstellt
Was passiert bei einem Alkoholiker nun mit dem GABA-Glutamat-System? Suchttherapeuten nennen Alkohol die schmutzigste Droge, die es gibt. Der Grund: Er manipuliert fast alle wichtigen Nervenbotenstoff-Systeme, die wir haben. Dopamin, Serotonin, Adrenalin, Noradrenalin und eben auch GABA und Glutamat.
Alkohol imitiert einerseits GABA und dockt an den entsprechenden Rezeptoren im Nervengeflecht an. So sorgt er für Entspannung. Den Effekt steigert Alkohol dadurch, dass er dem Glutamatsystem einen Knüppel zwischen die Beine wirft: Er schaltet die Glutamat-Rezeptoren einfach aus. Es kann dann so viel Glutamat im Nervensystem herum schwimmen, wie es will – wenn es nicht andocken kann, kann es auch nicht wirken.
Jetzt haben wir einen miesen Doppeleffekt. Alkohol tarnt sich als GABA und entspannt. Gleichzeitig schaltet er das Glutamatsystem ab – die nötige natürliche Gegenspannung und Wachsamkeit fällt damit aus. Diese künstliche Tiefenentspannung funktioniert – so lange jedenfalls, wie der Alkohol durch die Adern fließt.
Die Natur bemerkt den Schummel aber und steuert dagegen, um das System wieder zu reparieren. Heißt: Der Körper legt nicht nur die Bindungsstellen für das beruhigende GABA still, sondern erhöht gleichzeitig die Anzahl der Sensoren für das erregende Glutamat. Unter Alkohol-Dauerberieselung sprießen Glutamat-Andockstellen wie eine Blumenwiese im Frühling.
Gut ist das nicht, sondern ganz im Gegenteil ein mieser Teufelskreis: Zu wenige Sensoren für GABA verhindern die Entspannung. Gleichzeitig sind dann auch noch viel zu viele Rezeptoren für das Glutamat entstanden. Der Körper gerät damit immer mehr in einen Zustand der Dauer-Anspannung, kann nicht mehr runterfahren. Die schnelle Lösung: Der Alkohol, der GABA imitiert und das Glutamat vorübergehend in Schach hält.
Im Entzug: Wie GABA helfen kann – und wo die Risiken liegen
Regelmäßige Trinker können irgendwann nur noch mit Alkohol entspannen können. Im Extremfall werden sie fahrig, rast- und ruhelos, wenn der Stoff fehlt. Manchen beginnen, die Hände zu zittern, Schlafstörungen und Schweißausbrüche stellen sich ein. Das sind die sichtbaren Zeichen des gestörten GABA-Glutamat-Systems – und das ist es auch, was man landläufig als körperliche Abhängigkeit bezeichnet.
Im Entzug liegt dieses System dann endgültig in Schutt und Asche. Aus GABA entwickelte Medikamente wie Gabapentin, Pregabalin oder Baclofen werden im Alkoholentzug eingesetzt, um das Craving (den Druck, Trinken zu müssen) zu unterdrücken.
Beruhigungsmittel wie Benzodiazepine, die auch am GABA-Rezeptor ansetzen, helfen im akuten Entzug auch. Sie sind aber ein zweischneidiges Schwert, da sie schnell abhängig machen können. So mancher Alkoholiker merkte nach seinem erfolgreichen Alkoholentzug, dass er nur den Stoff getauscht hatte, der an seinem GABA-Glutamat-System herumschraubt – und sich eine neue Abhängigkeit aufgesackt hat.
Benzodiazepine helfen im Entzug – bergen aber selbst ein hohes Abhängigkeitspotenzial. Sie sollten nur kurzfristig und unter ärztlicher Aufsicht eingenommen werden.
Manche Betroffene in Selbsthilfeforen kombinieren GABA mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln wie L-Theanin, Magnesium oder Taurin und berichten von einer Verbesserung ihres allgemeinen Wohlbefindens während des Entzugsprozesses. Nicht alle Erfahrungsberichte sind aber positiv, einige User beschrieben auch, dass sie keine Wirkung verspürt hätten.
GABA als Nahrungsergänzung – was Anwender berichten
Eines kann man GABA nicht vorwerfen: Dass es abhängig macht.Trotzdem ist der Gedanken nicht schön, irgendetwas dauerhaft einzunehmen, auch wenn es ein Nahrungsergänzungsmittel ist. Die Erfahrung zeigt aber, dass das oft auch gar nicht nötig ist. So, wie sich eine Stress-Spirale immer weiter aufspulen kann, kann GABA offenbar das Ganze auch wieder zurückdrehen. Heißt: Nach einer Zeit der Entspannung und Ausgeglichenheit konnten aus meiner Beobachtung eigentlich alle dann auch die GABA-Menge wieder reduzieren, in der Regel auf Null. Vor allem dann, wenn eben gleichzeitig Veränderungen im Lebensstil vorgenommen wurden, Stress-Management und Entspannungsübungen erlernt wurden etc.
Viele setzen GABA später dann nur noch situationsbezogen ein. Also wenn sie merken, der Stress überrollt sie oder etwa eine Panik bahnt sich doch mal wieder an.
GABA gibt es quasi überall, online oder in Fitness-Shops. Ausnahme: England und die Schweiz. Qualitätsunterschiede sind kaum zu erwarten, denn es gibt weltweit nur drei Länder, in denen GABA als Rohware hergestellt wird: China, Japan und Südkorea. Das kommt dann in Riesenmengen nach Europa, wird von sogenannten Lohnabfüllern abgefüllt (entweder als Pulver oder verkapselt bzw. als Pressling) und mit dem Etikett des Verkäufers versehen.
Beim Kauf kann man sich daher auch am Preis orientieren. Bei Tabletten sollte man aber immer Dosierung und Stückzahl beachten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Kann GABA die Blut-Hirn-Schranke passieren?
Die klassische Lehrmeinung verneint das. Es mehren sich jedoch Hinweise auf Transportmechanismen an der Blut-Hirn-Schranke und auf indirekte Effekte über die Darm-Hirn-Achse. Praxisnah gesagt: GABA kann beruhigen, auch wenn der Transport ins Gehirn noch diskutiert wird.
Warum wirkt GABA beruhigend?
GABA ist der wichtigste hemmende Neurotransmitter. Es dämpft über den GABA-A-Rezeptor die Erregbarkeit von Nervenzellen. Das bremst Angst, Unruhe und Stressreaktionen. Glutamat steht auf der Gegenseite für „Aktivierung“. Balance ist der Schlüssel.
Was stellt Alkohol mit GABA und Glutamat an?
Alkohol imitiert GABA und blockiert gleichzeitig Glutamatrezeptoren. Kurzfristig fühlt sich das wie Entspannung an. Der Körper reagiert aber mit weniger GABA-Empfindlichkeit und mehr Glutamatrezeptoren. Das treibt Anspannung und Craving nach oben.
Hilft GABA im Entzug?
GABA kann Unruhe und Craving mindern. In Kliniken werden eher GABA-wirksame Arzneien wie Benzodiazepine, Gabapentin, Pregabalin oder Baclofen eingesetzt. Nahrungsergänzung ersetzt keine ärztliche Entzugsbehandlung, kann aber begleitend beruhigen.
Welche natürlichen Helfer passen zu GABA?
Häufig genannt werden L-Theanin, Magnesium und Taurin. Sie wirken teils über GABA-Signalwege, teils über Stress-Modulation. Kombinationen müssen nicht jeder Person helfen. Start immer niedrig, Wirkung beobachten und bei Unsicherheit ärztlich abklären.
Wie schnell spürt man Effekte?
Viele berichten über eine spürbare Beruhigung innerhalb von 30 bis 60 Minuten. Andere merken wenig. Schlaf, Koffein, Stress und Erwartungshaltung spielen mit hinein. Wirkung ist individuell.
Gibt es Risiken oder wer sollte aufpassen?
Nicht zusammen mit sedierenden Medikamenten ohne Rücksprache. In Schwangerschaft und Stillzeit nur nach ärztlicher Bewertung. Bei Schläfrigkeit nicht Auto fahren. Nahrungsergänzung ist kein Ersatz für Abstinenz, Therapie und Schlafhygiene.
Unterschied zu Benzodiazepinen?
Benzodiazepine verstärken die GABA-Wirkung sehr stark und können abhängig machen. GABA als Nahrungsergänzung greift sanfter an. Für akute Entzüge sind Benzodiazepine ein Klinik-Werkzeug. Für den Alltag gilt: so wenig und so kurz wie möglich, immer ärztlich geführt.
Übersicht über wichtige Literatur zum Thema Blut-Hirn-Schranke und GABA
1950 – GABA entsteht aus Glutamat
Roberts und Frankel konnten erstmals nachweisen, dass Gamma-Aminobuttersäure (GABA) im Gehirn vorkommt – und biochemisch aus Glutamat gebildet wird. Sie isolierten freie Aminosäuren aus Gehirngewebe mittels Papierchromatographie und Ninhydrin-Färbung – Verfahren, die aus heutiger Sicht primitiv erscheinen, aber damals den Stand der Technik darstellten. Es war die Geburtsstunde der GABA-Forschung.
Funktionelle Aussagen über die Rolle von GABA als Neurotransmitter konnten sie noch nicht treffen – dafür fehlten elektrophysiologische Methoden. Dennoch legte diese Arbeit die biochemische Grundlage für alles, was später zur inhibitorischen Signalübertragung bekannt wurde.
Roberts E, Frankel S. gamma-Aminobutyric acid in brain: its formation from glutamic acid. J Biol Chem. 1950;187(1):55–63. PMID: 15421926
1956 – GABA als hemmender Neurotransmitter?
In dieser Übersichtsarbeit entwirft Roberts das Konzept von GABA als hemmendem Neurotransmitter – eine Hypothese, die zu jener Zeit noch nicht bewiesen war. Er stützt sich auf biochemische Beobachtungen und pharmakologische Experimente mit GABA-Analoga und beschreibt erstmals systematisch die Idee einer “Gegensteuerung” zur erregenden Glutamat-Wirkung.
Rückblickend zeigt dieser Artikel, wie fruchtbar wissenschaftliche Intuition sein kann – auch ohne vollständigen methodischen Unterbau. Es war eine Meinungsarbeit im besten Sinne: klug argumentiert, richtungsweisend, offen für Korrektur durch spätere Daten.
Roberts E. Gamma-aminobutyric acid and nervous inhibition. Pharmacol Rev. 1956;8(4):427–443.
2001 – GAT2/BGT-1: GABA-Transport an der Blut-Hirn-Schranke
Diese Arbeit wies nach, dass der Transporter GAT2/BGT‑1 GABA an der Maus-Blut-Hirn-Schranke spezifisch aufnehmen kann – unter physiologisch regulierten Bedingungen. Dazu wurden molekularbiologische Techniken (RT-PCR, Western Blot, Immunfärbung) mit funktionellen Aufnahmestudien an Endothelzelllinien kombiniert, inklusive radiomarkierter [³H]GABA-Transporte.
Takanaga et al. zeigten damit, dass GABA nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist – sondern selektiv passieren kann, wenn die Transporter aktiviert sind. Eine wichtige Korrektur der immer wieder zitierten Annahme, GABA könne „nicht durch die BHS“.
Takanaga H, Ohtsuki S, Hosoya KI, Terasaki T. GAT2/BGT‑1 as a system responsible for the transport of γ‑aminobutyric acid at the mouse blood-brain barrier. J Cereb Blood Flow Metab. 2001;21(10):1232–1239. PMID: 11598501
2012 – GAT2-Knockout verändert GABA und Taurin im Gehirn und in der Leber
Zhou und Kollegen untersuchten in einem Knockout-Mausmodell die Funktion des GABA-Transporters GAT2 (SLC6A13). Nach Deletion des Gens zeigten sich deutliche Veränderungen der GABA- und Taurin-Konzentrationen – nicht nur im Gehirn, sondern auch in der Leber. Das unterstreicht, dass GABA-Transportprozesse nicht auf das ZNS begrenzt sind, sondern auch periphere Wirkungen haben.
Gerade für eine potenzielle therapeutische Modulation der GABA-Transporter ist diese Arbeit relevant, da sie aufzeigt, wie systemisch verwoben die Effekte sein können – mit möglichen Off-Target-Wirkungen außerhalb des Gehirns.
Zhou Y, Holmseth S, Guo C, et al. Deletion of the γ-aminobutyric acid transporter 2 (GAT2 and SLC6A13) gene in mice leads to changes in liver and brain taurine contents. J Biol Chem. 2012;287(42):35733–35746. DOI: 10.1074/jbc.M112.368175
2024 – GABA als postbiotischer Signalstoff in der Darm-Hirn-Achse
Braga und Kollegen zeigen, dass GABA auch im Darm – durch bestimmte probiotische Mikroorganismen – gebildet werden kann. In ihrem Review diskutieren sie, wie diese mikrobielle GABA-Produktion über die Vagus-vermittelte Darm-Hirn-Achse neurobiologische Prozesse beeinflussen könnte, ohne dass GABA selbst die Blut-Hirn-Schranke durchqueren muss.
Der Artikel fasst aktuelle tierexperimentelle und präklinische Daten zusammen und beschreibt GABA als möglichen „postbiotischen Mediator“ im Kontext von Stress, Angst, Depression und Sucht. Besonders relevant ist diese Perspektive für die Diskussion über orale GABA-Gaben: Ihre Wirkung könnte – entgegen klassischer Dogmen – doch zentral vermittelt sein.
Braga JD, Thongngam M, Kumrungsee T. Gamma‑aminobutyric acid as a potential postbiotic mediator in the gut–brain axis. npj Sci Food. 2024;8:16. DOI: 10.1038/s41538-024-00253-2
2024 – GABA-Transporter als therapeutisches Ziel
Askari et al. analysieren alle bekannten GABA-Transporter (GAT1–3, BGT‑1) im Hinblick auf ihre Rolle bei neurologischen Erkrankungen und ihre therapeutische Modulierbarkeit. Der Artikel gibt einen systematischen Überblick über aktuelle Inhibitoren, genetische Knockouts, Expressionsmuster und potenzielle Wirkstoffdesigns.
Besonders spannend ist die Diskussion möglicher Nebenwirkungen durch unspezifische Hemmung – sowie Strategien, um GATs gewebespezifisch oder temporär zu beeinflussen. Für Leser mit medizinisch-pharmakologischem Hintergrund bietet der Artikel eine fundierte Orientierung über aktuelle Forschung und Therapieansätze.
Askari M, et al. Ways of modulating GABA transporters to treat neurological disease. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2024. PMID: 39068514
Aktuelle Beiträge in unserem Blog
- Video-Blog: Dry January– mehr Veränderung, als viele erwarten
- Holiday-Heart-Syndrom: Wenn Alkohol Deinen Herzschlag zur Rave-Party macht
- Wie Alkohol den Blutdruck dauerhaft in die Höhe treibt
- Weihnachten ohne Alkohol ist machbar!
- Warum Ex-Trinker oft müde, nervös und gereizt bleiben – die unterschätzte Rolle von Vitaminmangel
- Rückfall – „alles verloren“ oder „macht nichts“?
- Wie Alkohol das wichtigste Vitamin für Dein Gehirn systematisch zerstört
- Nüchtern über den Weihnachtsmarkt – geht das überhaupt?
- Bin ich schon Alkoholiker?
- Träumen vom Alkohol – Rückfallgefahr oder gutes Zeichen?

Dr. med. Bernd Guzek
Arzt, Autor, Angehöriger & Mitbegründer von Alkohol adé
Beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den biochemischen Grundlagen von Sucht und Hirnstoffwechselstörungen sowie deren Beeinflussung durch Nährstoffe.